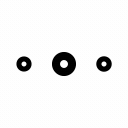Es genügt, wenn ein Händler einen Verbraucher bei einem Online-Geschäft (hier: Neuwagenkauf im Fernabsatz) über die Widerrufsmöglichkeit belehrt, indem er als Kontaktdaten seine Postanschrift und E-Mail-Adresse angibt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hält es für unschädlich, wenn keine Faxnummer angegeben ist – selbst wenn der Händler zuvor den Widerruf per Fax angeboten hat.
Am 18.04.2022 und am 15.06.2022 erwarb ein Verbraucher von einer Kfz-Händlerin jeweils ein Neufahrzeug im Wege des Fernabsatzes. Die Verkäuferin, die auf ihrer Internet-Seite unter „Kontakt“ ihre Telefonnummer und im Impressum erneut ihre Telefonnummer und dort zusätzlich auch ihre Telefaxnummer angegeben hat, verwendet nicht die Musterwiderrufsbelehrung, sondern eine in Teilen davon abweichende Belehrung. Dort teilt sie ihre Postanschrift und E-Mail-Adresse mit, nicht aber ihre Telefon- und ihre Telefaxnummer. Dazu heißt es, dass der Widerruf „mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)“ erklärt werden könne.
Am 17.09.2022 wurde dem Käufer das zuerst erworbene Fahrzeug übergeben, am 28.12.2022 das zweite. Am 24.08.2023 widerrief er per E-Mail seine auf den Abschluss der Kaufverträge gerichteten Erklärungen. In der Folge klagte er auf Rückzahlung des jeweiligen Kaufpreises, Zug um Zug gegen Rückgabe der Fahrzeuge – ohne Erfolg. Vor dem BGH begehrte er die Zulassung der Revision. Auch damit scheiterte er: insbesondere habe die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung, so der BGH.
Der BGH verweist auf seinen Beschluss vom 25.02.2025, der einen im Wesentlichen gleichgelagerten Parallelfall betraf (VIII ZR 143/24). Hier habe er bereits entschieden, dass die fehlende Angabe der Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung dem Anlaufen der Widerrufsfrist nicht entgegensteht.
Nunmehr hat der BGH entschieden, dass die Rüge der Nichtzulassungsbeschwerde ohne Erfolg bleibt, dem Anlaufen der Widerrufsfrist habe entgegengestanden, dass die Händlerin in der Widerrufsbelehrung nicht auch ihre Telefaxnummer angegeben habe beziehungsweise die auf ihrer Internetseite angegebene Telefaxnummer nach dem Käufer-Vortrag nicht erreichbar gewesen sei, obwohl in der Widerrufsbelehrung auf die Möglichkeit eines Widerrufs per Telefax verwiesen wurde.
Der BGH hat es als offenkundig angesehen, dass weder dem Wortlaut des Artikels 6 Absatz 1h der Verbraucherrechterichtlinie, dem Kontext der Bestimmung noch den vom EU-Gesetzgeber verfolgten Regelungszielen zu entnehmen ist, dass der Unternehmer in einer Widerrufsbelehrung seine Telefaxnummer anzugeben hat, wenn er in der Widerrufsbelehrung – wie hier – seine Postanschrift sowie seine E-Mail-Adresse mitteilt. Insoweit gölten die Ausführungen im Beschluss vom 25.02.2025 zu einer unter diesen Umständen entbehrlichen Mitteilung der Telefonnummer des Unternehmers entsprechend.
Dem Anlaufen der Widerrufsfrist stehe es bei richtlinienkonformer Auslegung der Vorschriften der § 356 Absatz 2 Nr. 1a, Absatz 3 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch auch nicht entgegen, wenn im Impressum der Internetseite der Verkäuferin eine unrichtige oder nicht erreichbare Telefaxnummer angegeben worden sein sollte, obwohl in der Widerrufsbelehrung die Möglichkeit eines Widerrufs per Telefax erwähnt ist. Denn eine – unterstellt – insoweit unrichtige Widerrufsbelehrung sei unter den gegebenen Umständen nicht geeignet, sich auf die Befähigung des Verbrauchers, den Umfang seiner aus dem Fernabsatzvertrag herrührenden Rechte und Pflichten – konkret: seines Widerrufsrechts – einzuschätzen, beziehungsweise sich auf seine Entscheidung, den Vertrag zu schließen, auszuwirken.
Der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher würde selbst bei einer fehlerhaften Angabe der Telefaxnummer nicht irregeführt und von einer rechtzeitigen Ausübung des Widerrufsrechts abgehalten, wenn der Unternehmer – wie hier – sowohl seine Postanschrift als auch seine E-Mail-Adresse mitteilt, über die der Verbraucher schnell mit ihm in Kontakt treten und effizient kommunizieren kann. Ein solcher Verbraucher, der einen vergeblichen Übermittlungsversuch mittels eines – im Übrigen ohnehin weitgehend überholten – Kommunikationsmittels, hier in Form eines Telefaxschreibens, vergeblich versucht hätte, würde sodann ein effizientes Kommunikationsmittel wählen, das der Käufer hier in Gestalt einer E-Mail auch von vornherein tatsächlich gewählt habe.
Der BGH hat überdies in Anknüpfung an seinen Beschluss vom 25.02.2025 nochmals hervorgehoben, dem Anlaufen der Widerrufsfrist stehe hier auch der Umstand nicht entgegen, dass die Widerrufsbelehrung einleitend das Bestehen eines Widerrufsrechts (abstrakt) an die Verbrauchereigenschaft des Käufers („Wenn Sie ein Verbraucher sind…“) und an die ausschließliche Verwendung von Fernkommunikationsmitteln knüpft. Der Sinn und Zweck der Widerrufsbelehrung sei vielmehr in Fällen wie dem vorliegenden – im Anwendungsbereich der Verbraucherrechterichtlinie – auch erfüllt, wenn der Verbraucher (abstrakt) darüber informiert wird, unter welchen gesetzlichen Voraussetzungen ihm ein Widerrufsrecht zusteht. Eine Rechtsbelehrung im Einzelnen dahingehend, ob diese – häufig in der Sphäre des Verbrauchers liegenden – Umstände im konkreten Einzelfall gegeben sind, obliege dem Unternehmer nicht. Vielmehr obliege es dem Verbraucher, anhand der Umstände des Einzelfalls selbst zu beurteilen, ob die genannten Voraussetzungen des Widerrufsrechts in seinem Fall gegeben sind.
Dem Anlaufen der Widerrufsfrist stehe auch nicht entgegen, dass die Verkäuferin in ihrer Widerrufsbelehrung dem Käufer zwar mitgeteilt hat, er habe die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen, entgegen Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 Halbs. 2 Einführungsgesetz zum BGB jedoch keine – zumindest schätzungsweise – Angaben zur Höhe der Kosten der Rücksendung gemacht hat. Das hindere jedoch das Anlaufen der Widerrufsfrist nicht. Denn die Folgen einer fehlerhaften Belehrung über die Kosten seien in § 357 Absatz 5 BGB abschließend und vorrangig geregelt.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 22.07.2025, VIII ZR 5/25