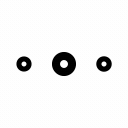Welche Anforderungen gelten hinsichtlich einer zwischen einer Mandantin und ihren Rechtsanwälten vereinbarten zusätzlichen Vergütung nach Abschluss des Mandats? Diese Frage hatte das Landgericht (LG) Koblenz zu beantworten.
Eine Frau wurde durch eine Rechtsanwaltskanzlei außergerichtlich in einer Schadens- und Schmerzensgeldsache vertreten. Bei Mandatserteilung schlossen die Parteien schriftlich eine „Zusatzvereinbarung zur anwaltlichen Vergütung“. Darin hieß es: „Die Parteien sind sich einig, dass im Falle des Erfolgs die Frage einer zusätzlichen, über die gesetzliche Regelung hinausgehenden Vergütung noch einmal besprochen wird.“ Im Rahmen der außergerichtlichen Verhandlungen schloss die Kanzlei für ihre Mandantin einen Vergleich ab, nach dem die Mandantin 150.000 Euro erhalten sollte. Diese Summe wurde von der Gegenseite gezahlt und ging auf dem Konto der Kanzlei ein. Danach kam es zu einem Telefonat zwischen der Klägerin und der Kanzlei, in dem über die Zahlung einer freiwilligen zusätzlichen Vergütung gesprochen wurde, Der genaue Inhalt des Gesprächs ist zwischen den Parteien streitig.
Die Kanzlei stellte der Mandantin sodann eine „Erfolgsunabhängige Vergütung, Vergütungsvereinbarung § 3a RVG, §§ 4, 3a RVG“ über einen Betrag von 20.000 Euro zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer, insgesamt somit 23.800 Euro in Rechnung. In einer Textnachricht an die Mandantin bedankte sich die Kanzlei für die „entgegenkommende und anerkennende Zahlung der zwischen uns besprochenen Zusatzvergütung von 20.000 Euro netto“ und erteilte Abrechnung. Dabei zog sie von den erhaltenen 150.000 Euro Rechtsanwaltsgebühren von 23.800 Euro ab und kehrte nur den verbleibenden Zahlbetrag (126.200 Euro) an die Mandantin aus. Die Mandantin forderte die Auskehrung des vollen Betrags.
Das LG Koblenz hat die Kanzlei zur Zahlung verurteilt. Die Mandatin habe einen entsprechenden Anspruch, weil die von der Kanzlei behauptete Vereinbarung wegen Verstoßes gegen die Formvorschrift des § 3a RVG nicht formwirksam zustande gekommen sei.
Der von der Kanzlei geltend gemachte Vergütungsanspruch stelle kein Erfolgshonorar dar, weil keine Vergütung vereinbart worden sei, deren Entstehen von einer aufschiebenden Bedingung eines – je nach Einzelfall näher definierten – Erfolges der anwaltlichen Tätigkeit abhängig gewesen sei.
Das Gericht hat es jedoch aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme als erwiesen angesehen, dass die Parteien telefonisch eine Vereinbarung über die Gewährung einer zusätzlichen Vergütung in Höhe von 23.800 Euro zugunsten der Kanzlei getroffen haben. Bei dieser handele es sich um eine dem § 3a Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) unterfallende Vergütung.
Bereits dem Wortlaut und Wortsinn nach liege eine Vergütungsvereinbarung vor, da mit dieser Vereinbarung die Kanzlei für ihre erbrachte anwaltliche Tätigkeit (wenn auch zusätzlich) entlohnt, mithin vergütet werden sollte. Die Kanzlei habe selbst in der von ihr vorformulierten „Zusatzvereinbarung zur anwaltlichen Vergütung“, in mehreren Textnachrichten und der Kostenrechnung stets das Wort „Vergütung“ aufgeführt. Zudem verwende das Gesetz den Begriff „Vergütungsvereinbarung“ dann, wenn eine höhere oder eine niedrigere als die gesetzlich festgelegte Vergütung zwischen Anwalt und Mandant vereinbart werden soll. Somit gelte § 3a RVG, wovon die Kanzlei wohl auch selbst ausgegangen sei. Denn mit ihrer Kostenrechnung habe sie eine „Erfolgsunabhängige Vergütung, Vergütungsvereinbarung § 3a RVG, §§ 4, 3a RVG“ in Rechnung gestellt.
Für die abgeschlossene Vereinbarung gelte somit das Formerfordernis der Textform, wovon nicht abgewichen werden könne. Der vereinzelt in der Literatur vertretenen Auffassung, dass es ohne Einhaltung von irgendwelchen Formalien möglich sein müsse, mit dem Mandanten nach Abschluss des Mandats einen wie auch immer gestalteten Zuschlag oder Bonus zu vereinbaren, schloss sich das LG nicht an. Die unterschiedliche Situation zu Beginn und nach Abschluss des Mandats vermöge kein Abweichen von der Formvorschrift zu begründen. Die Schutzbedürftigkeit des Mandanten möge zwar nach Abschluss des Mandats geringer sein, sie entfalle jedoch aufgrund der grundsätzlich überlegenden Erfahrung des Rechtsanwalts bei solchen Verhandlungen nicht vollständig.
Die Mandantin verstoße auch dadurch, dass sie sich auf die Formunwirksamkeit beruft, nicht gegen Treu und Glauben. Der Formmangel eines Rechtsgeschäfts sei nur ganz ausnahmsweise wegen unzulässiger Rechtsausübung unbeachtlich, weil sonst die Formvorschriften des bürgerlichen Rechts ausgehöhlt würden. Eine solche Ausnahme liege jedoch nicht vor. Die Mandantin habe weder die Kanzlei schuldhaft von der Einhaltung der Schriftform abgehalten, noch nach Abschluss der Vereinbarung, auf deren Formunwirksamkeit sie sich beruft, Vorteile aus dem Vertrag gezogen oder durch ein Handeln ein berechtigtes Vertrauen der Kanzlei auf die Wirksamkeit des Vertrages begründet, aufgrund dessen die Kanzlei irgendeine Leistung erbracht hätte.
Aufgrund des Verstoßes gegen die Textform könne somit die Beklagte gemäß § 4b RVG keine höhere als die gesetzliche Vergütung fordern. Da die gesetzliche Vergütung, die Geschäftsgebühr, bereits an die Kanzlei bezahlt worden sei, bestehe ein darüberhinausgehender Vergütungsanspruch, mit dem die Kanzlei gegen den unstreitigen Auszahlungsanspruch hätte aufrechnen können, nicht.
Die Kanzlei sei daher zur Herausgabe des einbehaltenen Fremdgeldes in Höhe von 23.800 Euro verpflichtet.
Landgericht Koblenz, Urteil vom 18.12.2024, 15 O 97/24, noch nicht rechtskräftig